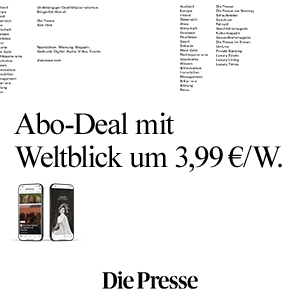IAB-Frühstück als schwer verdauliche Kost
Beim „Business Breakfast“ des iab austria diskutieren Vertreter der Digitalwirtschaft über Glaubwürdigkeit.

Am 12. November lädt das interactive advertising bureau austria – kurz iab – zum Business Breakfast unter dem Titel „Wem können wir noch trauen?“ in einen Besprechungsraum. Führende Köpfe kommen zusammen, um unterschiedliche Perspektiven auf Medienkompetenz, Verantwortung und Glaubwürdigkeit in Zeiten algorithmisch gesteuerter Informationsflüsse zu beleuchten.
Moderiert von Armin Rogl (Media Brothers) diskutieren Nana Siebert (Der Standard), Eva Maria Kubin (Content Performance Group), Rut Morawetz (Präsidentin iab austria), Julia Eisner (Women in AI) und Anna Neureiter (Data Intelligence Offensive). Die begleitende INTEGRAL-Studie, präsentiert von Bertram Barth, zeigt, wie brüchig Vertrauen geworden ist. KI-generierte Inhalte lassen sich kaum noch von der Realität unterscheiden – die Grenzen zwischen Fakt und Fake verschwimmen.
Das Thema ist gut gewählt: Desinformation, künstliche Intelligenz und die Erosion von Glaubwürdigkeit zählen zu den großen Herausforderungen der Gegenwart. Dass die Initiative dazu ausgerechnet von der Digitalwirtschaft aufgegriffen wird, ist legitim – und dennoch bemerkenswert. Denn sie ist Teil jener Maschinerie, deren Mechanismen die heimische Verlagsbranche seit Jahren unter Druck setzen.
Die Moral der Maschinen
Das iab ist kein Medienverband. Es ist die größte Interessenvertretung der Digitalwirtschaft – eine Lobby – und, wie der Name schon sagt, ein Advertising-Büro. Rund 200 Mitgliedsunternehmen, darunter internationale Konzerne, Mediaagenturen, Datenhändler und technische Dienstleister, bilden die unsichtbare Infrastruktur hinter dem Online-Werbemarkt. Sie entwickeln die Standards, nach denen digitale Werbung ausgespielt wird. Diese Standards bestimmen, welche Botschaften auf Laptops, Smartphones, TV-Screens und in Apps erscheinen.
Wer über Standards herrscht
Die Definitionen des iab reichen tief: Sie betreffen Anzeigengrößen, Tracking-Methoden, Geo-Targeting und das Consent-Management, das Nutzer zwingt, der Verarbeitung ihrer Daten zuzustimmen – inklusive geräteübergreifendem Tracking.
Das iab legt damit die Spielregeln fest, national wie international. Seine Arbeitsgruppen definieren, was als sichtbar, geklickt oder erfolgreich gilt. Diese Kennzahlen werden zum Maßstab, nach dem Mediaagenturen Kampagnen abrechnen und Erfolgsberichte erstellen.
Kurz gesagt: Das iab ist die Schaltstelle der digitalen Werbeökonomie – es formuliert die Parameter, nach denen Werbung im Netz funktioniert: von der Dauer einer Impression über Messmethoden bis zur technischen Infrastruktur des Programmatic Advertising.
Die Doppelrolle der Agenturen
An der Schnittstelle zwischen Werbung und Plattformen agieren die Mediaagenturen – offiziell Planer und Berater, in der Praxis aber technische Dirigenten des globalen Werbeorchesters. Sie bedienen dieselben Systeme, die das iab standardisiert hat: automatisierte Auktionen, Echtzeit-Platzierungen, datengetriebenes Targeting.
Ihr Ziel ist Effizienz, ihre Folge Abhängigkeit. Je mehr Daten sie auswerten, desto stärker geraten sie in die Systeme, deren Regeln sie befolgen. Ohne Cookies, ohne ein funktionierendes Consent-Management-System und ohne Zugriff auf Zielgruppen-Daten könnten sie keine Kampagnen steuern. Damit werden Agenturen zu Motoren einer Werbeökonomie, die mit jedem Klick an Wert gewinnt – und mit jedem User-Profil ein Stück Transparenz verliert.
Wie Werbung heute verkauft wird
Digitale Werbung unterscheidet sich grundlegend von klassischen Direktkampagnen. Früher wurden Werbeplätze – etwa Bannerflächen oder Pre-Rolls – direkt bei Verlagen gebucht und mit einem fixen TKP (Tausender-Kontakt-Preis) abgerechnet. Heute läuft der Großteil über Programmatic Advertising: automatisierte Marktplätze, auf denen Ad-Inventare in Echtzeit gehandelt werden.
Der Preis entsteht dort sekundenschnell – als CPC (Cost per Click) oder dynamischer TKP – je nach Nachfrage, Zielgruppendichte und Nutzerverhalten. Der Vorteil: hohe Präzision. Der Nachteil: Der direkte Bezug zwischen Medium und Werbekunde geht verloren. Werbebudgets folgen dem Algorithmus, nicht mehr dem journalistischen Umfeld.
Für Verlage bedeutet das: Ihr „Inventar“, also die verfügbaren Werbeflächen, wird von internationalen Plattformen vermarktet und algorithmisch bepreist. Die Kontrolle über den Wert ihrer Reichweiten liegt längst außerhalb ihrer Hände.
Vom Werbegeschäft zum Datengeschäft
Die Dimensionen sind beachtlich. 2024 betrug der Gesamtumsatz der großen Tech-Konzerne – Alphabet (Google), Meta Platforms und Amazon – 1,04 Billionen US-Dollar, mit einem jährlichen Wachstum von über 20 Prozent.
In Österreich liegt das Werbevolumen laut Fokus-Zahlen bei rund acht Milliarden Euro; realistisch, nach Rabatten, etwa bei fünf Milliarden. Von dieser Summe fließen mittlerweile 2,7 Milliarden Euro an internationale Digitalkonzerne – Tendenz steigend.
Der größte Teil der heimischen Werbegelder verlässt also das Land. Mediaagenturen lenken sie dorthin, wo Algorithmen Budgets effizienter verwerten – auf ausländische Plattformen. Für nationale Medien bleibt weniger als die Hälfte der Erlöse.
Wenn Regulierung zur Überlebensfrage wird
Beim Future Day des ORF riefen Medienvertreter zuletzt nach staatlicher Unterstützung und klaren Regeln für digitale Plattformen. Die Forderung klingt richtig – aber ohnmächtig. Europa diskutiert, während in Brüssel Heerscharen digitaler Lobbyisten längst den Takt vorgeben. Nationale Gesetzgeber rufen nach Fairness, während globale Player mit der Skalierung ihrer Systeme Fakten schaffen. Werbebudgets wandern dorthin, wo sie sich algorithmisch präziser verwerten lassen.
Hinter der harmonischen Kulisse zeigt sich ein tieferliegendes Dilemma: Der Werbemarkt verschiebt sich weiter ins Ausland. Von geschätzten fünf Milliarden Euro jährlichen Werbevolumens verbleibt weniger als die Hälfte im Land – nicht zuletzt, weil Mediaagenturen das Geld dorthin lenken, wo es international am effizientesten eingesetzt werden kann. So wird nationale Wertschöpfung systematisch ausgelagert – unter dem Deckmantel globaler Effizienz.
Kampf gegen Message Control
Verlässliche Informationen sind das Fundament jeder Demokratie. ExtraDienst fühlt sich diesem Prinzip verpflichtet. Während Journalistinnen und Journalisten täglich gegen Desinformation, „Message Control“ und politische Spin-Maschinen ankämpfen, persiflieren Interessenvertretungen deren Aufgaben und drehen daraus ihr eigenes Narrativ.
Wem können wir noch trauen?
Wenn die Digitalwirtschaft zum Frühstück über Glaubwürdigkeit einlädt, ist das mehr als eine PR-Event. Es ist der Versuch, im Chor der Kritik die eigene Rolle in der Vertrauenskrise leiser klingen zu lassen. Im vermeintlichen Zusammenschluss gegen Fake News soll die Mitverantwortung an der Erosion des Vertrauens übertönt werden.
Das iab diskutiert über Medienkompetenz – und definiert zugleich die Mechanismen, nach denen Vertrauen ökonomisch verwertet wird. Wer die Algorithmen baut, nach denen Aufmerksamkeit verteilt wird, trägt auch Verantwortung für ihre Folgen.
Und so bleibt am Ende die Frage:
Wem können wir noch trauen?
Abonnieren Sie noch heute unseren Newsletter hier – und was Sie verpasst haben – lesen Sie hier.
(key)