Offen für Manipulation – so funktioniert Wikipedia
Obwohl Wikipedia auf Offenheit baut, liegt die Kontrolle bei einer kleinen Gruppe sogenannter „Senior Editors“.
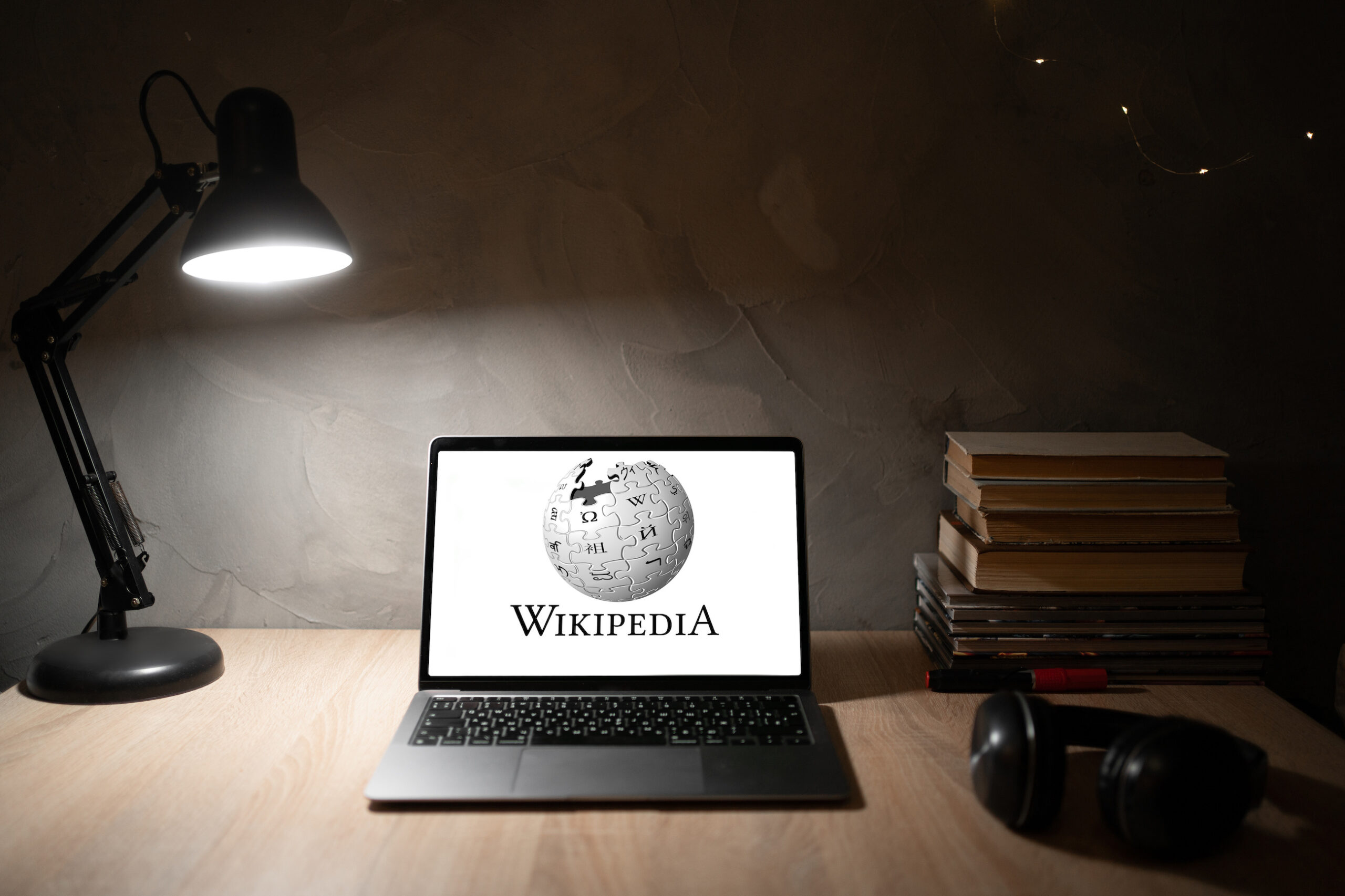
Wikipedia gilt als digitales Lexikon unserer Zeit. Mehr als 60 Millionen Artikel in Hunderten Sprachen machen das Projekt zur größten Wissensplattform der Welt. Doch der offene Charakter, der ihren Erfolg möglich machte, ist zugleich ihre größte Schwäche: Jeder darf mitschreiben – auch jene, die eigene Interessen verfolgen.
Die Grundidee ist einfach: Freiwillige erstellen und bearbeiten Artikel, andere überprüfen und ergänzen sie. So entsteht in der Theorie ein kollektives Korrektiv. In der Praxis aber zeigt sich, dass Machtstrukturen, Diskussionskulturen und thematische Schieflagen das Ideal der freien Enzyklopädie zunehmend infrage stellen.
Macht der Wenigen
Obwohl Wikipedia auf Offenheit baut, liegt die Kontrolle über Inhalte bei einer kleinen Gruppe sogenannter „Senior Editors“. Sie können Beiträge sperren, löschen oder Änderungen rückgängig machen. Ihre Entscheidungen sollen Neutralität sichern, führen jedoch häufig zu Spannungen: Wer gegen die Meinung dieser erfahrenen Nutzer anschreibt, hat meist geringe Chancen, Gehör zu finden. Kritiker sprechen von einer intransparenten Redaktion innerhalb einer angeblich basisdemokratischen Plattform.
Informationslücken und Interessenkonflikte
Wikipedia-Artikel werden in Echtzeit geändert, was Manipulationen erleichtert. Unternehmen, politische Organisationen oder PR-Agenturen nutzen das System, um ihre Darstellungen zu beeinflussen – oft über scheinbar neutrale Formulierungen oder selektive Quellenwahl. Themen, die eine engagierte Community haben, sind meist gut gepflegt; weniger populäre Bereiche hingegen bleiben oberflächlich oder veraltet. Diese Ungleichgewichtung spiegelt nicht das Wissen der Welt, sondern die Interessen ihrer aktivsten Autorinnen und Autoren.
Quellen und Diskussionskultur
Die Plattform verlangt belegte Informationen, doch die Qualität der Quellen variiert stark. Oft werden Online-Artikel zitiert, die selbst fehlerhaft oder unvollständig sind. Fachleute halten sich zurück, weil der Aufwand, sich in die komplexen Regelwerke und internen Machtstrukturen einzuarbeiten, hoch ist. Diskussionen über Formulierungen oder Relevanz finden auf schwer zugänglichen Unterseiten statt und sind für Außenstehende kaum nachvollziehbar.
Globale Bedeutung, lokale Verzerrung
Englischsprachige Artikel setzen vielfach den Ton und prägen auch die Wahrnehmung in anderen Sprachversionen. Nationale und kulturelle Unterschiede führen zu divergierenden Darstellungen – etwa in der Geschichtsschreibung oder politischen Bewertung. Die Idee der universellen Wissensgerechtigkeit stößt hier an ihre Grenzen.
Trotz aller Kritik bleibt Wikipedia die zentrale Wissensquelle im Netz. Ihre Einträge stehen auf den ersten Plätzen bei Google, sie fließen in Schulbücher, Nachrichtenrecherchen und KI-Trainingsdaten ein. Fehler, Einseitigkeiten oder Manipulationen haben dadurch weitreichende Folgen – sie wandern unbemerkt in das kollektive Wissen weiter.
(red)





