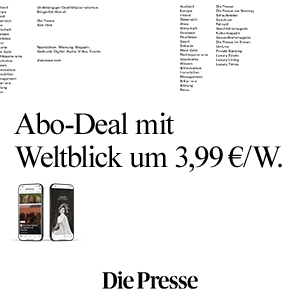Deutsche Medien fordern Bleiberecht in Washington
Der Fall eines kritisch berichtenden ZDF-Korrespondenten verleiht der Debatte um US-Visabeschränkungen neue Schärfe.

Der Druck auf deutsche Korrespondenten in den USA ist zuletzt deutlich gestiegen. Auslöser war die Attacke von Richard Grenell, dem früheren US-Botschafter in Berlin und nunmehrigen Sondergesandten von Präsident Donald Trump. Grenell bezeichnete ZDF-Studioleiter Elmar Theveßen in sozialen Medien als „Hetzer“ und „Linksradikalen“ und forderte, ihm das Visum zu entziehen. Anlass war eine Podcast-Aussage Theveßens, wonach der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, „sehr extreme Ansichten“ habe und ein Stück weit aus der Ideologie des Dritten Reiches komme.
Der Deutsche Journalistenverband (DJV) kritisierte Grenells Vorstoß scharf. „Zwangsmittel wie Visumentzug gegen Journalisten sind bisher nur von Autokratien bekannt“, betonte DJV-Chef Mika Beuster. Auch die Bundesregierung schaltete sich ein: Außenminister Johann Wadephul machte am Dienstag in Berlin klar, dass die freie Arbeit deutscher Journalistinnen und Journalisten in den Vereinigten Staaten nicht beeinträchtigt werden dürfe.
Symbolik und Realität
Parallel zur Causa Theveßen wehrt sich eine breite Front deutscher Sender gegen die geplante US-Visareform. Künftig sollen Aufenthalte ausländischer Journalistinnen und Journalisten auf 240 Tage beschränkt werden, mit Option auf Verlängerung. ARD, ZDF, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und Deutschlandradio appellierten gemeinsam an die Bundesregierung, auf diplomatischem Weg dagegen zu intervenieren. Die Petition, unterzeichnet von mehr als 100 internationalen Medienorganisationen, argumentiert: Nur mehrjährige Einsätze ermöglichten Korrespondenten, die USA glaubwürdig einzuordnen.
Doch ob diese Tiefe tatsächlich erreicht wird, stellen Kritiker der Berichterstattung in Frage. Sie behaupten, wer regelmäßig deutsche Korrespondentenbeiträge aus den USA verfolgt, erkenne selten exklusive Rechercheergebnisse. Stattdessen dominieren Einschätzungen, die sich erkennbar auf US-Medien wie die New York Times, die Washington Post oder CNN stützen. Für sie stellt sich die Frage, ob die Auslandsbüros – oft besetzt mit langgedienten Journalisten am Zenith ihrer Laufbahn – den erhofften Informationsgewinn liefern.
Anspruch und Wirklichkeit
Die unverblümte Kritik an Washington unter Präsident Trump ist insofern nachvollziehbar, als Visabeschränkungen in der Tat eine Form von Druck darstellen können. Aber das Pathos von Pressefreiheit und Demokratie, das in der Petition bemüht wird, steht in auffälligem Kontrast zu einer Berichterstattung, die in der Lesart vieler “neuer” Medien nicht über eine kommentierte Zweitverwertung amerikanischer Leitmedien hinausgeht.
Der Fall Theveßen zeigt, wie schnell Visa-Fragen politisch aufgeladen werden können. Zugleich legt die Diskussion offen, dass deutsche Auslandskorrespondenten ihre privilegierte Präsenz in den USA nicht immer in journalistischen Mehrwert übersetzen. Allzu oft spiegeln die Kommentare eher die innenpolitischen Linien im Heimatland wider – und lassen Zweifel aufkommen, ob die lautstarken Klagen der Medienvertreter wirklich durch die tägliche Praxis gedeckt sind. Ein uneingeschränktes Bleiberecht auf Basis eines Journalistenvisums ist zwar eine probate Voraussetzung, um diesen Anspruch zu erfüllen – aber keine Garantie.
(APA/red)