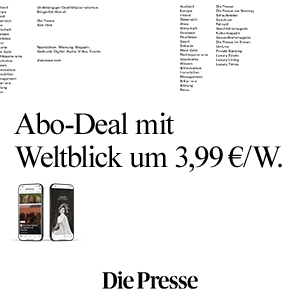Verliert der Presserat den eigenen Anspruch?
Der Presserat sucht Transparenz, riskiert dabei aber, auch den Schutz der Menschenwürde erneut zu verletzen.

Der Österreichische Presserat ist die zentrale Selbstkontrollinstanz des heimischen Journalismus. Seine Aufgabe besteht darin, Verstöße gegen den Ehrenkodex zu prüfen und auf Missstände in der Berichterstattung hinzuweisen. Ziel ist es, ethische Standards zu sichern und das Vertrauen in die Medienbranche zu stärken. Doch in jüngster Zeit steht das Gremium selbst in der Kritik – nicht wegen seiner Urteile, sondern wegen der Art, wie es sie veröffentlicht.
Die doppelte Bloßstellung
In einer aktuellen Aussendung, veröffentlicht über die APA-OTS, prangerte der Presserat einen Bericht über Gewalt an einer jungen Frau an – die ethische Bewertung legt dies nahe. Doch das Verfahren offenbart ein paradoxes Muster: Um die Verfehlung zu dokumentieren, wiederholt die Aussendung nahezu wortgetreu die ursprünglichen Schilderungen, nennt die Betroffene und beschreibt die beanstandeten Darstellungen in vielen Details.
Damit wird der ursprüngliche mediale Übergriff – die Entwürdigung und Sexualisierung des Opfers – im offiziellen Urteilstext noch einmal reproduziert. Eine sekundäre Verletzung, diesmal von der Instanz, die sie tadeln wollte.
Was als Transparenz gedacht ist, schlägt in mediale Exponierung um. Zwar ist die Veröffentlichung von Presserats-Entscheidungen international gängige Praxis, doch in anderen Ländern – etwa in Großbritannien oder Australien – werden sensible Passagen häufig anonymisiert oder gekürzt. Der Presserat hingegen veröffentlicht Entscheidungen im OTS-Format mit Namensbezug, bildhaften Beschreibungen und exakter Rekonstruktion der beanstandeten Inhalte.
Der Effekt: Der Presserat demonstriert ethische Kontrolle, verletzt dabei aber möglicherweise selbst jene Prinzipien des Persönlichkeitsschutzes (Punkt 5 und 6 des Ehrenkodex), die er verteidigt.
Das Anliegen, Fehlentwicklungen sichtbar zu machen, ist legitim. Medienethik lebt von Öffentlichkeit, nicht von Geheimverfahren. Doch die Form entscheidet über die Glaubwürdigkeit. Wenn Urteile zu Mini-Reportagen geraten, in denen jedes pikante Detail wiederholt wird, verliert das Verfahren seine moralische Distanz. Es wird – unbeabsichtigt – zum Teil des Problems.
Wenn Kritik zum Selbstzweck wird
Im selben medienethischen Spannungsfeld zeigt sich eine entgegengesetzte Fehlleistung: die Empörung über den Presserat selbst. In Teilen der Branche formierte sich lautstarker Widerstand – teils mit der Unterstellung, die Selbstkontrolle sei zum Zensurverein verkommen oder diene parteipolitischen Interessen. Auch das ist ein gefährlicher Kurzschluss.
Wo die Selbstkontrolle der Medien lächerlich gemacht wird, gerät die Idee des unabhängigen Journalismus unter Beschuss. Kritik an der Institution ist legitim; ihre pauschale Verächtlichmachung ist es nicht.
Ein Appell zur Selbstdisziplin
Beide Seiten, die Rügenden wie die Gerügten, täten gut daran, einen Schritt zurückzutreten.
Der Presserat sollte prüfen, ob seine Veröffentlichungsform dem eigenen Ethos gerecht wird – Transparenz darf nicht zur neuerlichen Bloßstellung führen. Und jene, die den Presserat reflexhaft als Zensur begreifen, sollten sich erinnern, dass Selbstkontrolle kein Angriff auf Pressefreiheit ist, sondern deren Voraussetzung.
(key)