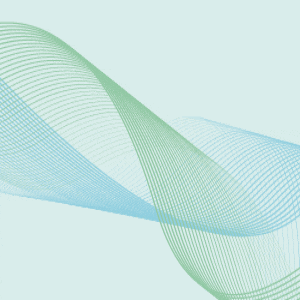Was gegen einen KI-Medien-Chatbot spricht
Eine KI für Medienmacher könnte Fakten bündeln und Inhalte personalisieren. Doch es gibt große Bedenken.

Führende Medienmanager skizzieren derzeit Modelle, die die Branche verändern könnten. Clemens Pig, seit 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung und geschäftsführender Vorstand der APA – Austria Presse Agentur, vor Kurzem für eine weitere fünfjährige Funktionsperiode bestätigt, brachte jüngst die Idee eines „GPT-Austria“ ins Spiel: ein gemeinsamer KI-Chatbot, der journalistische Inhalte transparent, rechtssicher und auf Basis geprüfter Daten ausspielen soll. Ergänzend sei ein „AI-Center“ als kollaborative Plattform denkbar, ebenso ein Media-Lab, das Tools zur Fake-News-Erkennung finanziert und Infrastrukturkosten durch gemeinsame Nutzung senkt. Unterstützung kommt auch von ORF, VÖZ und VÖP, die stärker auf Kooperation statt Konkurrenz setzen.
Der Reiz der Systemlösung
Klingt zunächst bestechend: Wer wünschte sich nicht eine technische Instanz, die Fakten prüft, rechtliche Unsicherheiten minimiert und Fake-News frühzeitig markiert? In Zeiten schrumpfender Budgets könnte ein solcher Chatbot auch eine Antwort auf die ökonomische Schieflage vieler Medienhäuser sein.
Der Haken an der Sache: „Geprüfte Inhalte“ bedeuten automatisch auch eine Letztinstanz, der sich menschliche Redakteur:innen in der Praxis kaum widersetzen können. Damit verlöre der Journalist, der für eine Meldung Verantwortung trägt, jene diskursive Freiheit, die Journalismus ausmacht.
Hinzu kommt: Wer heute etwa ChatGPT oder Gemini für Recherchezwecke nutzt, erlebt, dass Bias in KI-Systemen längst Realität sind. Bestimmte Argumentationslinien werden durchgewunken, andere fallen durch. Die KI entscheidet – und zwar tendenziell in eine Richtung.
Anspruch auf Deutungshoheit
Damit rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wer legt die Normen für einen Branchen-Chatbot fest? Eigentlich müssten es die einzelnen Redaktionen sein. Oder der Presserat, in dem die wesentlichen Player vertreten sind. Für Medienhäuser, die Unabhängigkeit als Kernwert reklamieren, ist das ein heikler Gedanke. Sogar unabhängige Journalisten, die gar nicht involviert sind, werden daran gemessen werden, wie der Medien-Chatbot urteilt. Dazu kommt: Schon jetzt haben Nicht-Redakteure maßgeblichen Einfluss auf die Redaktionen. Zudem reklamieren immer mehr Geschäftsführer den Titel eines Chefredakteurs, der nach wie vor mit besonderen Privilegien und Pflichten versehen ist.
So reizvoll die technischen Perspektiven sind: Ein Medien-Chatbot würde unweigerlich zu einer zentralisierten Deutungshoheit führen – und damit das Gegenteil dessen bewirken, wofür unabhängiger Journalismus steht. Die größere Gefahr ist nicht, dass eine KI Fehler macht, sondern dass sie keine Alternativen mehr zulässt.
(key)