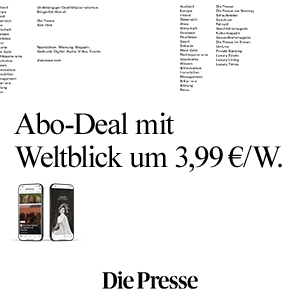Medien-Klausur: Ideen treffen auf Praxisprobleme
Bei der Klausur in Schloss Hernstein wurden Wege zur Stärkung der Medienvielfalt diskutiert – Kritik an Repräsentativität und Praxisnähe blieb aber bestehen.

Im Schloss Hernstein in Niederösterreich trafen sich am vergangenen Wochenende über zwei Tage 66 Persönlichkeiten um Impulse für die Weiterentwicklung und Absicherung der Medienvielfalt und -freiheit in Österreich zu setzen. Die Initiative „Acht Tische für die Vierte Gewalt“, getragen von „Ein Versprechen für die Republik“ und der Datum Stiftung für Journalismus und Demokratie, brachte dabei Vertreter von Medienverbänden, Politik, Start-ups und zivilgesellschaftlichen Organisationen an einen Tisch.
Medienförderung und Standards
Im Zentrum der Diskussionen standen die Weiterentwicklung der staatlichen Medienförderung, die Stärkung journalistischer Standards und die Regulierung von Big-Tech-Plattformen. Vorgeschlagen wurde, bestehende Förderungen zu vereinheitlichen und von unabhängigen Jurys nach objektiven Kriterien vergeben zu lassen. Besonders betont wurde die Förderung von Innovation, Resilienz und jungen Medienformaten. Transparentes Arbeiten und die Einhaltung journalistischer Standards sollten Voraussetzung für staatliche Unterstützung sein. Außerdem wurde empfohlen, die Werbeausgaben der Bundesregierung auf europäisches Durchschnittsniveau zu senken und die freiwerdenden Mittel in die Medienförderung zu investieren.
Recht und Bildung
Auch verfassungsrechtliche Absicherungen, etwa die explizite Verankerung des ORF und eines Bekenntnisses zur pluralistischen Medienlandschaft, sowie die konsequente Durchsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes, wurden diskutiert. Im Bereich der Digitalisierung wurde eine effizientere Regulierung von Big-Tech-Plattformen vorgeschlagen, ergänzt durch die Förderung europäischer Alternativen wie eines „European Public Open Space“. Große Bedeutung wurde auch der Medienkompetenz beigemessen, mit der Empfehlung, „Medien und Demokratie“ als fächerübergreifende Kompetenz in Schulen einzuführen.
Kritische Stimmen
Die Initiative stößt nicht auf einhellige Zustimmung. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bemängelt, dass der Teilnehmerkreis nicht ausreichend repräsentativ war. Geschäftsführer Gerald Grünberger kritisiert, dass viele Forderungen praxisfern seien und rechtliche Machbarkeit sowie konkrete Umsetzung weitgehend unberücksichtigt blieben. Zwar werden Ansätze wie die Förderung von Medienkompetenz, die Stärkung des Vertrauens in journalistische Angebote oder die Regulierung von Big-Tech-Plattformen positiv bewertet, doch insgesamt fehle es den Empfehlungen an einem realistischen Fundament, um breite Akzeptanz in der Branche zu erzielen.
Zwischen Chancen und Grenzen
Die Klausur in Hernstein macht deutlich, dass die Handlungsempfehlungen trotz ambitionierter Ideen nur begrenzt praxisnah sind. Die mangelnde Ausgewogenheit und Repräsentativität im Teilnehmerkreis im Sinne der gesamten österreichischen Medienbranche stellt einen erheblichen Kritikpunkt dar. Während einige Vorschläge, etwa die Förderung von Medienkompetenz oder die Regulierung von Big-Tech-Plattformen, sinnvoll erscheinen, bleibt unklar, wie viele der Ideen tatsächlich umsetzbar sind und von der Branche getragen werden könnten. Die Initiative zeigt damit sowohl kreative Ansätze als auch die Grenzen eines Prozesses, der ohne breite Branchenvertretung entstanden ist.
(PA/red)