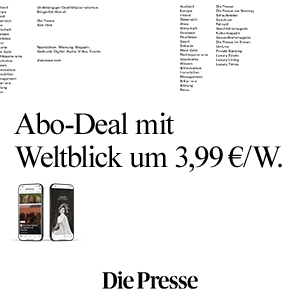Frauen im Netz sind jünger als sie sind
Eine internationale Studie belegt systematische Altersverzerrungen in Online-Darstellungen von Frauen.

Das Internet zeigt Frauen anders, als sie sind. Genauer gesagt: jünger. Eine im Fachmagazin Nature veröffentlichte Studie von Forschenden der Stanford University, der University of California und der Oxford University hat mehr als eine Million Bilder, Videos und Texte aus Suchmaschinen, Social-Media-Plattformen und KI-Anwendungen ausgewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Frauen werden in digitalen Darstellungen im Schnitt um mehrere Jahre jünger gezeigt, während Männer tendenziell älter und damit autoritärer wirken.
Diese Verzerrung zieht sich quer durch Berufsgruppen und Plattformen – von Google-Bildern über YouTube bis zu Wikipedia und Reddit. Selbst wenn tatsächliche Altersunterschiede zwischen Männern und Frauen in bestimmten Berufsfeldern existieren, werden sie online deutlich überzeichnet. Besonders stark zeigt sich der Effekt bei prominenten Persönlichkeiten, wo weibliche Gesichter im Durchschnitt zwanzig Jahre jünger erscheinen als männliche.
Dabei bleibt offen, wer die Verantwortung trägt. Die Algorithmen liefern nur, was sie lernen – und gelernt haben sie von uns. Die meisten Bilder stammen nicht von anonymen Datensammlern, sondern von Nutzerinnen und Nutzern selbst, die ihr digitales Ich häufig nach jugendlichen Maßstäben kuratieren. Der Wunsch nach Sichtbarkeit folgt dabei den gleichen Instinkten wie einst das Schönheitsideal im Spiegel: Wer jung wirkt, bleibt im Spiel.
KI verstärkt tradierte Rollenbilder
Die Forscher um Douglas Guilbeault führten zusätzlich Experimente mit Large-Language-Modellen wie ChatGPT durch. Dabei sollten die Systeme prototypische Lebensläufe für verschiedene Berufsgruppen erzeugen und anschließend selbst bewerten. Das Resultat: KI-generierte Profile beschrieben Frauen als jünger und empfahlen bei Bewerbungen häufiger Männer – ein klarer Bias, der in der realen Arbeitswelt fatale Folgen haben könnte.
Die Ursachen liegen in der Trainingslogik der Algorithmen. Sie lernen aus bestehenden Daten und damit auch aus gesellschaftlich verankerten Vorurteilen. Jugend wird als attraktiv und leistungsfähig codiert, Alter als Kompetenzmerkmal – aber überwiegend bei Männern. So reproduzieren digitale Systeme jene Stereotype, die sie eigentlich neutralisieren sollten.
Wem nützt die Altersdiskriminierung?
Studienleiter Douglas Guilbeault und sein Team weisen auf die strukturelle Benachteiligung von Frauen hin, die durch algorithmische Verzerrungen weiter verstärkt werde. Ihre Kritik richtet sich an die großen Plattformen – Google, Meta, OpenAI –, die aus ihrer Sicht gesellschaftliche Vorurteile nicht ausreichend korrigieren.
Doch gerade dieser Ansatz legt ein Paradox offen: Die Daten, aus denen Algorithmen lernen, stammen zu einem großen Teil von Nutzerinnen und Nutzern selbst. Jugendlichkeit wird freiwillig kuratiert, ästhetisch kodiert und sozial belohnt – lange bevor KI sie verstärkt. Die Systeme bilden also nicht nur Diskriminierung ab, sondern auch Selbstinszenierung.
Die eigentliche Altersdiskriminierung zeigt sich weniger in der Rechenlogik als in der gesellschaftlichen Einigung darauf, dass Jugendlichkeit im digitalen Raum nach wie vor als stärkste Währung gilt.
(ORF/red)
Das könnte Sie auch interessieren

Wayback: Wozu das Internet-Archiv dient

Wie Medien-Webseiten KI-Crawler steuern