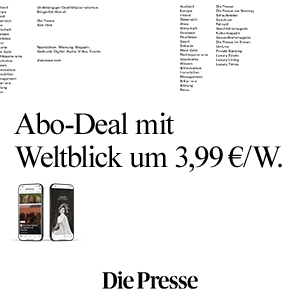Digitale Souveränität wird zum Prüfstein der Regierung
Neue Vergabekriterien der Bundesregierung könnten auch die Werbe- und Kommunikationsbranche verändern.

Nach dem Ministerrat am Mittwoch sprach Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll von nichts Geringerem als einem Wendepunkt. Österreich will weniger abhängig werden von außereuropäischen IT-Anbietern. Was auf den ersten Blick nach technischer Infrastruktur klingt, könnte in Wahrheit einen Paradigmenwechsel in der Vergabepolitik auslösen.
Denn wenn künftig die „digitale Souveränität“ selbst zum verpflichtenden Kriterium bei öffentlichen Aufträgen wird, betrifft das nicht nur Rechenzentren oder Cloud-Systeme. Es betrifft auch jene Branchen, die in hohem Maß mit Daten, Plattformen und automatisierten Prozessen arbeiten – und deren Werkzeuge vielfach aus Übersee stammen.
Und es betrifft auch unsere Branche. In der programmatischen Werbung etwa laufen die meisten Buchungs-, Analyse- und Targeting-Systeme über US-Plattformen. Europäische Alternativen sind bislang Nischenprodukte.
Sollte nun der Bund bei Aufträgen auf europäische Datenräume, Open-Source-Frameworks oder heimische Cloud-Infrastruktur bestehen, würde das den Markt grundlegend neu sortieren. Agenturen und Mediahäuser müssten ihre Technologie-Ketten überprüfen, Datentransfers hinterfragen und gegebenenfalls umstellen.
Wenn Technologie zur Standortfrage wird
Das Bundesrechenzentrum soll nun eine „souveräne Cloud-Infrastruktur“ schaffen. Parallel dazu soll geprüft werden, wo Open-Source-Lösungen europäischer Herkunft eingesetzt werden können. Dahinter steht ein Gedanke, der über alle Ressorts reicht: Wer künftig Bundes- oder EU-Aufträge will, muss nicht nur kreativ und kosteneffizient sein – er muss auch technologisch unabhängig agieren können.
Die Idee folgt dem Zeitgeist. Lieferketten, Energie und nun auch Daten sollen nicht länger Fremdbestimmung unterliegen. Für heimische Anbieter öffnet das neue Chancen. Für internationale Netzwerke, die auf globale Technologie-Stacks setzen, könnte es dagegen ungemütlich werden.
Wenig Hoffnung in EU-Charta
Ob die geplante EU-Charta zur digitalen Souveränität noch vor dem Gipfeltreffen am 18. November in Berlin steht, bleibt abzuwarten. Doch die Wunschrichtung ist klar: Europa will weniger Zulieferer, mehr Kontrolle, mehr Eigenständigkeit. Und jedes Unternehmen, das mit öffentlichen Budgets arbeitet, wird sich dieser neuen Logik stellen müssen.
Kommentar: Die Richtung klingt ambitioniert – die Realität ist ernüchternd. Die Regierung verweist auf Europa, wo sie selbst handeln müsste, und ruft nach einer „Charta“, während kein einziger nationaler Schritt gesetzt wurde.
So droht digitale Souveränität zu einer bloßen Vokabel zu werden: groß aufgeladen, wirtschaftlich folgenlos. Made in Austria – einst eine Formel des nationalen Stolzes, heute leere Floskel. Wenn Europa weiterhin nur reguliert statt entwickelt, wird der Traum von Unabhängigkeit zur Selbsttäuschung.
(APA/red/key)