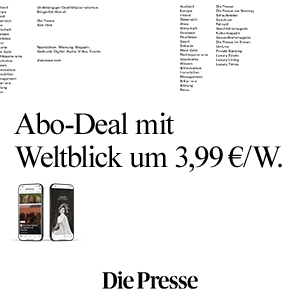Bundesliga-TV-Rechte-Schnaps-Idee Selbstvermarktung
Die Eigenvermarktung der TV-Rechte steht zur Diskussion – doch sie birgt hohe Risiken und wird heftig diskutiert.

Im Mai 2025 traf die österreichische Bundesliga eine weitreichende Entscheidung: Ab der Saison 2026/27 sollen die TV-Rechte nicht mehr an einen Sender vergeben, sondern erstmals über eine eigene Plattform vermarktet werden. Damit endet ein Modell, das seit Jahren Bestand hatte: Bis einschließlich der Saison 2025/26 hält Sky Österreich sämtliche Übertragungsrechte und zeigt alle Spiele live im klassischen Pay-TV.
Von Free-TV zu Pay-TV über Streaming
Mit der geplanten Eigenvermarktung soll nun ein Bruch vollzogen werden. Künftig wäre nicht mehr ein etablierter TV-Anbieter zuständig, sondern die Liga selbst – über eine digitale Plattform nach dem Prinzip anderer Streamingdienste. Für die Zuschauer:innen bedeutet das nicht, dass Fußball gänzlich aus dem klassischen Fernsehen verschwindet. Einzelne Partien würden weiterhin im Free-TV zu sehen sein – wie bisher beim ORF oder bei ServusTV, die in den vergangenen Jahren Rechtepakete hielten. Auch Zusammenfassungen und Analysen wären dort weiterhin möglich. Doch genau an diesem Punkt wird es kompliziert: Wie lassen sich die Preise gestalten, damit einerseits die Liga möglichst hohe Einnahmen erzielt und andererseits die Fans nicht mit teuren Abos oder Stadiontickets belastet werden?
Die Bundesliga setzt unbeirrt davon eine Entwicklung fort, die schon seit Jahren im Gang ist: Fußball hat sich in Österreich längst aus dem Vollprogramm des linearen Fernsehens verabschiedet. Die Hauptrechte lagen zuletzt exklusiv bei Sky. Free-TV-Anbieter wie ORF (Anm.: nicht so free wie gemeinhin kolportiert) oder ServusTV durften nur einzelne Spiele und Zusammenfassungen zeigen. Mit der geplanten Eigenvermarktung soll nun der nächste Schritt folgen – weg vom etablierten Pay-TV-Anbieter hin zu einer reinen Online-Lösung über Streaming.
Ursprünglich rechnete man mit bis zu 100.000 Abonnent:innen. Als Partner für die technische Infrastruktur ist die ProSiebenSat.1-Plattform Joyn im Gespräch, die bisher ein Gratis-Modell betreibt. Laut SN/APA sollte bis Jahresende ein konkretes Konzept vorliegen. Sky, das noch für die Saison 2025/26 alle Spiele überträgt, soll ein Angebot knapp unter 30 Millionen Euro vorgelegt haben, Canal+ lag deutlich darunter.
Die Eigenvermarktung klingt auf dem Papier attraktiv: mehr Kontrolle über Inhalte, direkter Draht zu den Fans, zusätzliche Erlösströme. Doch die praktische Umsetzung erweist sich als komplex. Schon die Produktionskosten belaufen sich laut Schätzungen auf mindestens fünf Millionen Euro jährlich. Hinzu kommen Ausgaben für Plattformaufbau und Marketing.
Alarmierende Szenarien im Vorfeld
Besonders kritisch äußerte sich oe24 im Vorfeld der Clubsitzung am Montag, 25. August. Das Portal sprach von einer „Harakiri-Aktion“ und warnte vor jährlichen Verlusten in Millionenhöhe, sollte die Eigenvermarktung tatsächlich umgesetzt werden. Laut den Berechnungen könnten bei maximal 20.000 Abonnenten Defizite von drei bis fünf Millionen Euro entstehen, im ungünstigsten Fall sogar bis zu acht Millionen. Ein Liga-Funktionär wurde mit den Worten zitiert: „Alles andere als eine Einigung mit Sky wäre Selbstmord mit Anlauf.“
Warum die TV-Rechte so wichtig sind
Dass die Diskussion so hitzig geführt wird, liegt an der Bedeutung der Fernseheinnahmen für die Vereine. Für die Top-Clubs wie Red Bull Salzburg, Rapid Wien oder Sturm Graz sind die TV-Gelder ein solider Bestandteil des Budgets – aber nicht der einzige. Sie profitieren zusätzlich von Sponsoring, internationalen Einnahmen aus Europacup-Bewerben und Ticketverkäufen. Für kleinere Vereine wie Altach, Ried oder Hartberg sind die TV-Gelder dagegen ein überlebenswichtiger Fixpunkt. Fällt dieser Anteil weg oder schrumpft deutlich, geraten die Finanzen schnell ins Wanken.
Gerade Vereine, die keine internationale Bühne erreichen, leben stark von den zentralen Erlösen der Liga. Ein Rückgang um mehrere Millionen Euro wäre für sie kaum zu kompensieren. Die Abhängigkeit vom Fernsehvertrag erklärt daher, warum sich vor allem die kleineren Clubs laut oe24 mittlerweile gegen die Eigenvermarktung stellen.
Sponsoren und ihre Reichweite
Hinzu kommt ein Aspekt, der im Fußballgeschäft oft unterschätzt wird: Sponsoren. Unternehmen investieren nicht nur wegen der Stadionatmosphäre, sondern vor allem wegen der Reichweite. Je mehr Menschen ein Spiel im TV oder Stream verfolgen, desto attraktiver sind Bandenwerbung, Trikotsponsoring und Hospitality-Angebote. Sinkt die Reichweite drastisch, drohen Sponsoren abzuspringen oder ihre Verträge zu verkleinern.
Die Sorge vieler Clubchefs ist deshalb nicht allein das mögliche Minusgeschäft beim Abo-Verkauf. Es geht auch um den langfristigen Schaden am Markenwert der Liga. Während Sky und andere Sender für eine breite Sichtbarkeit sorgen, wäre eine reine Eigenplattform auf eine deutlich kleinere Zielgruppe beschränkt. Statt 100.000 Zuseher:innen pro Spiel könnten es am Ende nur ein paar Tausend sein – eine Dimension, die für Sponsoren wenig attraktiv klingt.
Große Clubs, kleine Clubs
Die Dynamik innerhalb der Liga ist dabei unterschiedlich. Vereine mit großer Anhängerschaft wie Rapid Wien oder Sturm Graz können auf eine treue Fanbasis bauen, die auch für ein eigenes Abo eher in die Tasche greifen würde. Red Bull Salzburg hat zusätzlich die Finanzkraft eines Konzerns im Rücken. Für Clubs mit kleinerem Stadion und geringerer Anhängerschaft gilt das nicht. Dort ist man stärker von zentralen Einnahmen abhängig, die bei einer gescheiterten Eigenvermarktung ausbleiben könnten.
So wird verständlich, warum laut Berichten aus dem Umfeld insbesondere Altach, Austria Wien und der LASK gegen das Projekt auftreten, während Salzburg, Sturm und Rapid eher abwarten – sie verfügen über die größten finanziellen Polster.
Sportvermarktung in Österreich
Die Diskussion um die Bundesliga ist kein Einzelfall. Auch andere Sportverbände in Österreich haben mit der Vermarktung ihrer Rechte zu kämpfen. Der Österreichische Skiverband setzte lange auf Partnerschaften mit ORF und internationalen Sendern, musste aber mehrfach nachjustieren, als Quoten sanken oder Sponsoren absprangen. Im Eishockey war es zuletzt ebenfalls nicht einfach, verlässliche TV-Partner zu finden.
Das zeigt: Sportrechte sind ein sensibles Geschäft. Einerseits sind sie begehrt, weil Live-Sport weiterhin hohe Einschaltquoten bringt. Andererseits sind Märkte wie Österreich zu klein, um dauerhaft große Summen wie in Deutschland oder England aufzurufen. Eine eigenständige Plattform auf die Beine zu stellen, ist daher besonders riskant.
Der Zeitfaktor
Hinzu kommt, dass die Zeit drängt. Die Saison 2026/27 beginnt in weniger als einem Jahr nach Auslaufen des aktuellen Sky-Vertrags. Eine komplett neue Plattform aufzubauen, inklusive Technik, Abrechnungssystemen, Kundenservice und Marketing, ist in so kurzer Zeit eine Mammutaufgabe. Brancheninsider zweifeln, ob das realistisch umsetzbar ist. Andererseits mag es oberflächlich betrachtet nicht kompliziert wirken, Spiele live zu streamen und über eine Online-Schnittstelle weiterzureichen. Doch sobald die Übertragungen die gleiche Qualität wie bei Sky erreichen sollen, zeigt sich, wie aufwendig die Umsetzung tatsächlich ist.
Fest steht: Die Clubs wollen in den kommenden Wochen über die TV-Rechte entscheiden. Ob sie an der Eigenvermarktung festhalten oder doch einen Vertrag mit Sky abschließen, ist derzeit offen. Klar ist nur: Die Weichenstellungen rund um die TV-Rechte werden den österreichischen Fußball langfristig prägen – sportlich, finanziell und in seiner öffentlichen Wahrnehmung.
(red)
Das könnte Sie auch interessieren

Wayback: Wozu das Internet-Archiv dient

Wie Medien-Webseiten KI-Crawler steuern