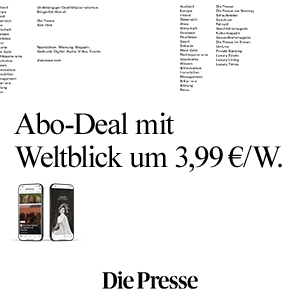Amtsgeheimnis war einmal – oder doch nicht
Das neue Gesetz soll Amtsverschwiegenheit beenden, doch Journalisten zweifeln an echter Transparenz.

Seit Montag ist das Amtsgeheimnis Geschichte. Nach mehr als hundert Jahren Gültigkeit wurde es abgeschafft und durch das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ersetzt. Bürgerinnen und Bürger haben nun ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen. Behörden sind verpflichtet, Daten von allgemeinem Interesse proaktiv zu veröffentlichen. Der Anspruch auf Auskunft kann nur verweigert werden, wenn schutzwürdige Interessen vorliegen.
Hoffnung auf mehr Transparenz
Das klingt nach einem historischen Schritt in Richtung Transparenz. Denn bisher konnten öffentliche Stellen Informationen pauschal verweigern – ein Verweis auf das Amtsgeheimnis genügte. „Infos waren im Grunde nur unter der Hand zu erhalten“, schildert ORF-Investigativjournalistin Ulla Kramar-Schmid. Dieses System habe sowohl Informantinnen als auch Journalistinnen über Jahrzehnte an den Rand des Amtsmissbrauchs gedrängt.
Auch Martin Thür vom ORF sieht einen Wendepunkt: Ausgelagerte Gesellschaften wie das Arbeitsmarktservice hätten sich bisher oft der Auskunftspflicht entzogen. Nun seien sie eindeutig umfasst. „Das Amtsgeheimnis war mehr eine Ausrede als eine echte Hürde“, so Thür.
„Kulturelles Amtsgeheimnis“
Doch nicht alle glauben an den großen Befreiungsschlag. „In der Praxis berufen sich Behörden viel lieber auf den Datenschutz – pauschal und ohne Interessenabwägung“, sagt „Standard“-Redakteur Sebastian Fellner. Er spricht von einem „kulturellen Amtsgeheimnis“, das viel wirkmächtiger sei als die alte Rechtslage. Ähnliche Erfahrungen teilt Jakob Winter vom „profil“. Selbst banale Informationen, wie die Miethöhe von SPÖ-Sektionslokalen im Gemeindebau, seien mit Verweis auf Datenschutz jahrelang blockiert worden.
Auch die Rechercheplattform Dossier erinnert an einen jahrelangen Rechtsstreit mit dem Gesundheitsministerium über Infektionszahlen. Erst nach drei Jahren und mehreren Gerichtsbeschlüssen kamen die Daten ans Licht. „Der Staat hielt Informationen selbst dann zurück, wenn sie eindeutig im öffentlichen Interesse lagen“, so Dossier-Journalist Georg Eckelsberger.
Neuer Rechtsrahmen, alte Hindernisse?
Unter dem neuen Gesetz sind auch staatsnahe Unternehmen erfasst. Fellner spricht von einer „Goldgrube“, sofern die Stellen ihre Veröffentlichungspflichten ernst nehmen. Eckelsberger sieht Potenzial für „einen riesigen Pool an Dokumenten für Recherchen“, insbesondere in Verbindung mit KI-gestützter Auswertung.
Gleichzeitig warnen viele vor neuen Blockaden. Behörden könnten weiterhin den Datenschutz vorschieben oder aufwändige Abwägungen nutzen, um Informationen hinauszuzögern. „Ich erwarte, dass wir auch künftig Anfragen mit konstruierten Argumenten abprallen sehen“, meint Winter. Thür befürchtet ein „grobes Hemmnis“, da künftig betroffene Personen vor einer Auskunft informiert werden müssen.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Ob das Ende des Amtsgeheimnisses tatsächlich einen Kulturwandel einleitet, ist offen. Zwar verpflichtet das Gesetz Behörden erstmals zur proaktiven Transparenz. Doch solange Verstöße ohne Sanktionen bleiben, könnte sich der neue Rechtsrahmen als zahnlos erweisen. Die Skepsis in der Branche ist spürbar – und viele befürchten, dass das „Amtsgeheimnis“ in anderer Form weiterlebt.
(ORF/red)