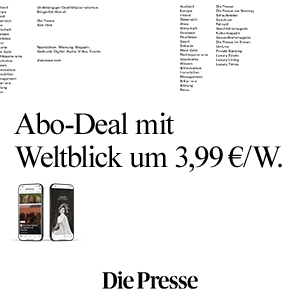Der ORF-Beitrag bleibt – die Debatte auch
Der VfGH hat entschieden, aber die Kritik an ORF-Struktur und -Finanzierung ist damit nicht verstummt.

Der Verfassungsgerichtshof hat gesprochen: Die Haushaltsabgabe zur Finanzierung des ORF ist rechtens. Sie sei sachlich gerechtfertigt, gleichheitskonform und verfassungsgemäß – so das Erkenntnis vom 1. Juli. Doch während juristisch Klarheit herrscht, bleiben medienpolitisch viele Fragen offen. Vor allem: Welchen Rang hat der ORF im Mediengefüge – und was unterscheidet ihn noch von einem klassischen öffentlichen Dienst?
Alte Stimmen, neue Gültigkeit
Kaum ein medienpolitisches Vorhaben der letzten Jahre wurde so heftig kritisiert wie die ORF-Digitalnovelle 2023 – und zwar vor allem vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ). Dort sprach man von einem drohenden „Meinungsmonopol“, warnte vor der „Staats-Tageszeitung“ orf.at und kritisierte eine ausufernde digitale Expansion zulasten privater Medien. In einem symbolischen Protest ließ der VÖZ den Inhalt von orf.at auf 70 Papierseiten drucken – als Beweis dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk längst zur tagesaktuellen Online-Konkurrenz mutiert sei.
Der damalige VÖZ-Präsident Markus Mair ließ keinen Zweifel: Man brauche einen klar definierten, eingehegten ORF – keinen staatsnahen Medienkonzern mit Vollausstattung. Und Gerald Grünberger warnte zum Tag der Pressefreiheit 2023 vor einem drohenden „Meinungsmonopol des ORF“. Gefordert wurde eine strikte Trennung: weniger Text, mehr Video, klare audiovisuelle Ausrichtung – und eine Rückbesinnung auf den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag.
Doch obwohl viele dieser Forderungen nicht eins zu eins umgesetzt wurden, gab es sehr wohl spürbare Reaktionen. Der ORF öffnete sich für Kooperationen. Mit dem neuen Streamingangebot „ORF ON“ wurde eine Plattform geschaffen, auf der perspektivisch auch Drittanbieter eingebunden werden können. Im Audiobereich ging man mit „SOUND ON“ einen ähnlichen Weg: 16 Privatradios sind heute Teil der App. Und auch mit Privat-TV-Anbietern wie ServusTV oder krone.tv bestehen punktuelle Kooperationen – ein Szenario, das in der Zeit des ORF-Monopols undenkbar gewesen wäre.
Darüber hinaus wurden auch mehrere Zeitungen unter den ORF-Schirm geholt: Marketingdeals nach dem Prinzip – ihr druckt unser Fernsehprogramm, wir ermöglichen Werbespots zur Primetime – Goldes wert.
Diese Zugeständnisse sind weniger ein Entgegenkommen als ökonomische Notwendigkeiten. Im digitalen Raum konkurriert jeder mit jedem – selbst öffentlich-rechtliche Anbieter können sich dieser Realität nicht entziehen. Wer Reichweite und Sichtbarkeit sichern will, muss Inhalte vermarkten, Reichweiten teilen, Synergien nutzen.
Das Urteil des VfGH hat bei den Privaten kaum Reaktionen hervorgerufen. Das Match um die Hoheitsmacht scheint nun endgültig entschieden worden zu sein.
Von „Zwangssystem“ bis „Pfusch“
Emotionaler als die Verlegerverbände reagierten politische Akteure auf den Urteilsspruch – und tun es noch. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker sprach von einem „astreinen Gesetzes-Pfusch“ und fantasierte über ORF-Vignetten für Radfahrer. Die unbedeutende MFG sieht die Republik längst im „Zwangssystem“ angekommen und zweifelt an der Unabhängigkeit des Gerichts selbst.
Anders die SPÖ: Mediensprecher Klaus Seltenheim nennt das Erkenntnis ein „gutes Signal“ für Medienvielfalt und Demokratie. Für den langjährigen Publikumssprecher Heinz Lederer, ein Verfechter des Public Value, bestätigt das Urteil, was immer schon gegolten habe: Dass Grundversorgung kein Konsumprodukt ist, sondern ein öffentlicher Dienst.
Zwischen Infrastruktur und Intervention
Auch aus wissenschaftlichen Kreisen kommt Unterstützung – wenn auch nicht ohne Nuancen. Medienökonom Matthias Karmasin spricht in diesem Zusammenhang von einer „demokratiepolitischen Infrastruktur“ und verweist auf den ORF als öffentliches Gut, vergleichbar mit Spitälern oder Parkanlagen. Medienforscher Andy Kaltenbrunner wiederum sieht in der Beitragspflicht eine legitime Form gesamtgesellschaftlicher Verantwortung – sofern sie mit klaren Regeln und Transparenz einhergeht.
Doch wie selbstverständlich ist ein System, das sich rechtlich aus jeder Affäre zieht, aber gesellschaftlich zunehmend Rechtfertigungsdruck spürt? Die juristische Absicherung durch den VfGH ist eindeutig – aber sie ersetzt keine öffentliche Debatte über Auftrag, Umfang und Grenzen eines Rundfunks, der seine Unabhängigkeit via Gerichtsentscheid legitimieren musste. Wer sich auf das Gemeinwohl beruft, muss auch bereit sein, sich daran messen zu lassen.
Denn der zentrale Vorwurf bleibt: Der ORF sei zu groß, zu reichweitenstark, zu wenig kontrolliert – und seine Gremien zu politisch besetzt. Daran hat das Urteil nichts geändert. Es hat lediglich klargestellt, dass man auch ohne Nutzungspflicht zur Finanzierung verpflichtet ist. Es sei eben eine Infrastrukturleistung.
Wäre der ORF tatsächlich reine Infrastruktur, müsste er sich der politischen Einflussnahme entziehen. Genau hier liegt das Unbehagen: ein unabhängiger ORF, der wie ein Ministerium agiert, aber keiner Regierung verpflichtet ist. Ein Beitrag, der wie eine Steuer wirkt, aber keine ist. Eine GIS-Gebühr, die es mal war.
Und ein Verfassungsgericht, das seine politische Distanz betont und dem System ORF seinen Segen gegeben hat. Während ehemalige ORF-Leitfiguren als Kanzlerkandidaten gehandelt werden, Nachrichtensprecher auf Parteibühnen und Moderatoren im Werbefernsehen jegliche Grenzen verschwimmen lassen.
Brüderlein urteilt nicht über Schwesterlein
Die Entscheidung des VfGH ist formal korrekt – darüber gibt es nicht zu diskutieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein Anrecht auf Finanzierung. Aber wer beurteilt in letzter Instanz seine Grenzen? Und wer kontrolliert die Instanzen?
Formell ist der ORF durch ein mehrstufiges System von Kontrollgremien reguliert: allen voran durch den Stiftungsrat, der als zentrales Aufsichtsorgan über Budget, Programmstrategie und Geschäftsführung entscheidet. Ergänzt wird dieser durch den Publikumsrat, der repräsentative Rückmeldungen aus der Gesellschaft bündeln soll, sowie durch externe Prüfungseinrichtungen wie den ORF-Rechnungshof-Kontrollausschuss. Auf medienrechtlicher Ebene übernimmt die Kommunikationsbehörde KommAustria die Regulierung – etwa bei Beschwerden oder Missachtung des öffentlich-rechtlichen Auftrags.
Doch diese Mechanismen sind nicht frei von Kritik: In der Zusammensetzung des Stiftungsrats spiegelt sich nach wie vor das parteipolitische Kräfteverhältnis wider – und ausgerechnet dort, wo Unabhängigkeit gefordert wird, bleibt die institutionelle Nähe zum politischen System ein dauerhafter Faktor.
Zahlungszwang für Nutzungsmöglichkeit
Wenn sich die Argumentation auf den Begriff der „Nutzungsmöglichkeit“ stützt, bleibt die Gefahr bestehen, dass auch andere Bereiche diesen Maßstab für sich reklamieren. Warum nicht eine verpflichtende Schienennutzungsgebühr für alle Haushalte einführen – schließlich kommt ohne Gleise keine Ware ins Land? Oder eine Mineralölpauschale für alle – Mobilität ist schließlich ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen, auch ohne eigenes Fahrzeug. Würde die Austrian Airlines in Staatsbesitz übergehen, könnte man sie mit einem verpflichtenden „Luftfahrtbeitrag“ finanzieren – denn in geopolitisch heiklen Zeiten braucht jedes Land seine eigene Fluglinie, ob man sie nutzt oder nicht.
Vielleicht ist die eigentliche Erkenntnis: Der ORF soll unabhängig bleiben und gleichzeitig kontrolliert werden. Beides mag beruhigen – oder beunruhigen. Und somit steht fest:
Der Beitrag bleibt. Die Debatte auch.
(red)
Das könnte Sie auch interessieren

Wayback: Wozu das Internet-Archiv dient

Wie Medien-Webseiten KI-Crawler steuern